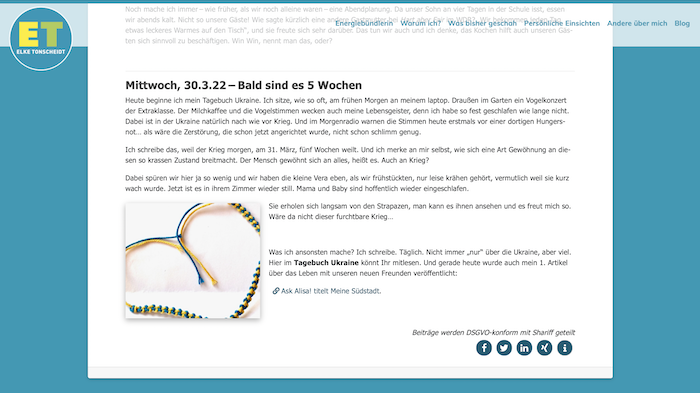Heute haben Oma und ich an einer tollen Konferenz teilgenommen. Es war die 3. ohfamoose Unkonferenz, die sich mit dem Thema Unser neues Miteinander auseinandergesetzt hat und erstmals digital durchgeführt wurde. Ich selbst habe einen Impuls zum Thema Wahrheit und Lügen gehalten, den ich Opas Blog-Lesern nicht vorenthalten will:
Wahrheit und Lüge sind untrennbar miteinander verbunden. Ich will das an einem Beispiel verdeutlichen:
Ihr habt sicher schon einmal vom Lügner-Paradoxon gehört. Der Klassiker lautet: Dieser Satz ist falsch.
Es handelt sich dabei um die einfachste Form des Lügner-Paradoxons, das dann entsteht, wenn ein Satz seine eigene Unwahrheit behauptet. Seine Selbstbezüglichkeit dreht der Logik eine Schlinge, in der sie sich heillos verheddert. Ein unauflöslicher Widerspruch tut sich auf: Wenn der Satz zutrifft, ist er das, was er aussagt: falsch. Ist er falsch, muss er richtig sein. Und so weiter.
Nachdem damit alle Klarheiten bzw. Wahrheiten beseitigt sind, will ich mich jetzt intensiver mit dem Lügen beschäftigen.
Denn: Wir alle lügen. Mehrmals am Tag.
Der Psychologe Gerald Jellison von der Universität von South Carolina hat herausgefunden, dass der Mensch durchschnittlich alle acht Minuten belogen wird. Während einer zehnminütigen Konversation belügen sich danach 60 Prozent aller Gesprächspartner bis zu drei Mal. Das bedeutet: Täglich sind wir mit einer kaum vorstellbaren Menge an Unwahrheiten, Übertreibungen und anderen Formen von Lügen konfrontiert und lügen unsererseits nicht selten genauso häufig.
Doch warum tun wir das?
Beiläufige Flunkereien sind laut Jellison den Urhebern im Augenblick der Konversation meist gar nicht bewusst, machen aber fast ein Drittel aller Lügen aus. Der Rest sagt vor allem aus vier Kernmotiven heraus die Unwahrheit:
– 41 Prozent lügen, um sich Ärger zu ersparen („Dein Essen schmeckt super!“).
– 14 Prozent schummeln, um sich das Leben bequemer zu machen („Morgen? Oh, da kann ich nicht!“).
– 8,5 Prozent manipulieren, um geliebt zu werden („Ich denke nur an dich!“).
– 6 Prozent schwindeln aus Faulheit („Klar, habe ich daran gedacht!“).
Die schönste Beschreibung, die ich in diesem Zusammenhang gelesen bzw. gehört habe, lautet: Die soziale Lüge ist das Schmierfett unserer Gesellschaft und macht unser Leben erst lebenswert.
Das gilt natürlich nur, wenn man es nicht übertreibt.
Meister der Übertreibung in diesem Zusammenhang ist … genau: Donald Trump.
Nach Berechnungen der Zeitung »Washington Post« brauchte Trump lediglich 601 Tage im Amt, um in der Öffentlichkeit 5000 „unwahre oder irreführende“ Aussagen zu machen. Seinen persönlichen Rekord erzielte der scheidende US-Präsident dabei am 7. September 2018 – mit 125 Unwahrheiten an einem einzigen Tag.
Auch wenn der Alte Fritz Trump nicht kannte, ist er zu der Erkenntnis gelangt:
Seit ich die Menschen kenne, liebe ich die Hunde. Und so wollte Friedrich, der am 17. August 1786 im Schloss Sanssouci in Potsdam in seinem Sessel starb, neben seinen Hunden beerdigt werden. Da hat er allerdings nicht gewusst, dass auch Hunde sozusagen schwindeln können.
Das jedenfalls legt eine britische Studie im Fachblatt „Scientific Reports“ nahe. Danach können Hunde ihre Mimik – darunter den sprichwörtlichen Dackelblick – gezielt zu Kommunikationszwecken einsetzen. Die Biologin Juliane Kaminski von der Universität Portsmouth und ihr Team hatten 2017 Experimente mit insgesamt 24 Familienhunden verschiedener Rassen gemacht.
In einer früheren Studie hatte Kaminski bereits belegt, dass Hunde erkennen, wie aufmerksam Menschen gerade sind. So stibitzten sie in einem Versuch öfter Futter, wenn der Mensch sich wegdrehte oder die Augen schloss.
Auch hier ist also die soziale Lüge das Schmierfett der Hund-Mensch-Beziehung, wobei wir wieder beim Menschen wären, bei dessen Sprache es die Lüge bis in die Sprichworte gebracht hat.
Eines der geläufigsten lautet: Lügen habe kurze Beine, was ausdrücken soll, dass man mit Lügen nicht weit kommt. Ein anderes, auch sehr schönes Sprichwort heißt: Die Lüge bedarf gelehrter, die Wahrheit einfältiger Leute, was nichts anderes heißt, dass Lügenkonstrukte irgendwann so komplex geworden sind, dass man schon sehr intelligent sein muss, um am Ende noch den Durchblick und die Kontrolle zu haben.
Ein kleiner Witz macht das sehr gut deutlich:
Ein Mann war über Nacht nicht zu Hause. Am Morgen erzählt er seiner Frau, dass er bei einem Kumpel übernachtet hätte. Seine Frau rief daraufhin zehn seiner besten Freunde an. Abends stellt sie ihren Gatten zur Rede. „Ich habe zehn deiner Freunde angerufen. Fünf haben mir bestätigt, dass du bei ihnen geschlafen hast. Und drei behaupten, dass du immer noch bei ihnen wärst.“ Man könnte sagen, sie hat seine Lüge sozusagen ad absurdum geführt und ihn im wahrsten Sinne des Wortes Lügen gestraft.
Wie eng Lüge und Wahrheit zusammenhängen und miteinander verbunden sind, macht ein Text deutlich, den der englische Philosoph Francis Bacon verfasst hat. Denn es ist sicher kein Zufall, dass in seinem Essay „Of Truth“ das Wort „Wahrheit“ mit zwölf Mal nur einmal mehr vorkommt als das Wort „Lüge“, das elf Mal zu lesen ist.
Schließen will ich mit einem Gedicht von Heinrich Heine.
Gott gab uns nur einen Mund,
Weil zwei Mäuler ungesund.
Mit dem einen Maule schon
Schwätzt zu viel der Erdensohn.
Wenn er doppeltmäulig wär’,
Fräß’ und lög’ er auch noch mehr.
Hat er jetzt das Maul voll Brei,
Muß er schweigen unterdessen,
Hätt’ er aber Mäuler zwei,
Löge er sogar beim Fressen.
Was soll ich sagen? Wir haben lebhaft diskutiert. Und auch hier ist die Diskussion jetzt eröffnet.